Einen Guten Rutsch und alles Gute im Jahr 2026! Theologie, Gewaltfreiheit
Erstellt am:
Gesichter von Rassismus sind vielfältig. Dazu gehören unter anderem: Krieg als extremste Ausdrucksform von Faschismus, Völkermord sowie die Mitwirkung und Ermöglichung daran, Militarisierung, der Aufbau von Feindbildern wie der pauschale Hass gegen Russland, politische Verfestigung von Armut – Alters- und Kinderarmut usw. –, Hetze gegen Geflüchtete und der systematische Abbau ihrer Rechte, Hochsicherheitslager für Geflüchtete wie Vastria, Abschiebelager, staatliche Überwachung, Zensur, Einschüchterung, religiöse Symbole an staatlichen Behörden, soziale Ausgrenzung und weitere Formen struktureller Diskriminierung.
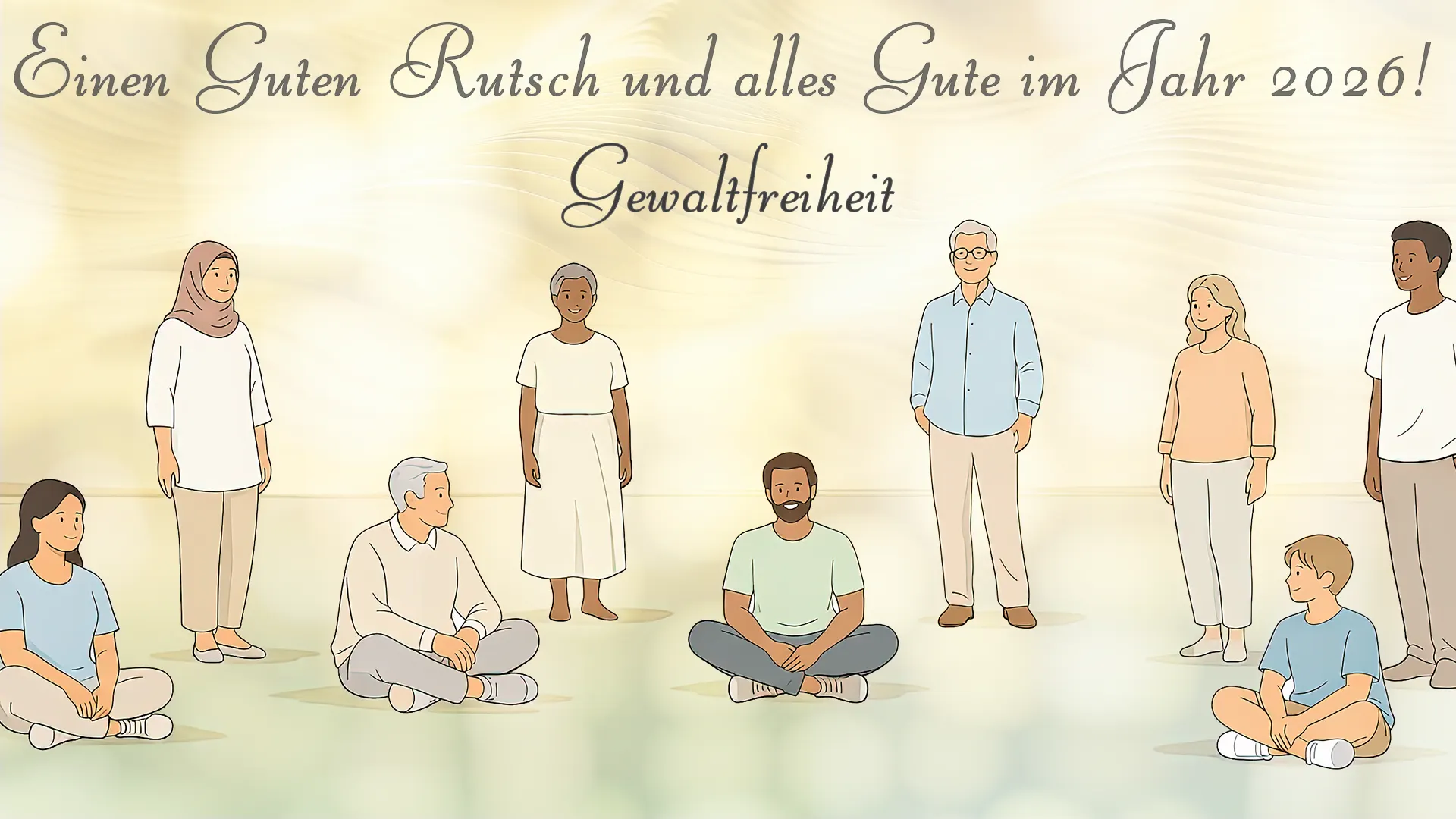
Gewaltfreiheit beschreibt „Agape“ am begreiflichsten. Allen ein Guten Rutsch und ein gesegnetes Jahr 2026
Im Zentrum der Geschichte Jesu steht Gewaltfreiheit. Sie prägt sein Handeln auch in der Barmherzigkeit gegenüber denen, die ihm feindlich gesinnt sind – oft zusammengefasst unter dem Begriff der Feindesliebe. Diese Haltung erschöpft sich jedoch nicht im religiösen Raum. Auch jenseits kirchlicher Kontexte lassen sich Formen von Gewaltverzicht und barmherziger Konfliktbearbeitung beobachten, die umso deutlicher sichtbar machen, dass die Kirche ihrem eigenen Auftrag zur Gewaltfreiheit in der gelebten Praxis nicht gerecht wird.
Jesu Wirken ist untrennbar mit dem Reich Gottes verbunden. Wo Menschen ihr Leben an dem im Neuen Testament bezeugten Weg Jesu ausrichten, setzen sie diese Bewegung fort. Doch in einer Welt, die dieses Reich noch nicht anerkennt, bleibt ein solches Zeugnis nicht spannungsfrei. Es ruft Widerspruch hervor und führt zur Konfrontation – so wie es auch im Leben Jesu selbst sichtbar wird. Seine Auseinandersetzung mit den Mächten des Bösen hatte tödliche Konsequenzen. Erst das, was uns die Auferweckungstexte überliefern, bestätigt sein Leben und Handeln als glaubwürdigen Ausdruck des anbrechenden Reiches Gottes.
Ein eindrückliches Beispiel dafür bietet die Erzählung von der Heilung der verdorrten Hand (Lk 6,6–11). Jesus handelt hier nicht beiläufig, sondern bewusst öffentlich. Er ruft den betroffenen Mann in die Mitte und wartet, bis alle Blicke auf ihm ruhen. Erst dann fordert er ihn auf: „Streck deine Hand aus.“ Die Heilung geschieht nicht im Verborgenen, sondern als sichtbares Zeichen. Sie macht deutlich, wofür das Reich Gottes steht: für Wiederherstellung, für Heilung, für das Leben.
Gerade darin liegt die Provokation. Denn dieses Handeln widerspricht den geltenden Sabbatvorschriften, die solche Tätigkeiten untersagen. Jesus stellt die Regel nicht theoretisch infrage, sondern durch eine konkrete Tat. Dass es ihm dabei nicht um einen Einzelfall geht, zeigt sich an anderer Stelle, wenn der Synagogenvorsteher fordert, Heilungen auf die übrigen Wochentage zu beschränken (Lk 13,14). Das Reich Gottes tritt hier in Spannung zu einer religiösen Ordnung, die sich selbst genügt, aber den leidenden Menschen aus dem Blick verliert.
Diese Spannung ist kein Missverständnis, sondern gehört zum Kern von Jesu Wirken. Wo das Reich Gottes Gestalt gewinnt, geraten bestehende Ordnungen unter Druck. Nicht durch Gewalt, sondern durch ein Handeln, das Prioritäten neu setzt: Der Mensch steht nicht im Dienst des Gesetzes, sondern das Gesetz im Dienst des Lebens.
In diese Reihe öffentlicher Zeichen gehört auch die sogenannte Tempelreinigung, wohl eines der umstrittensten Handlungen Jesu. Unabhängig davon, welches konkrete Unrecht hier im Einzelnen kritisiert wird, ist deutlich: Jesus greift bewusst in einen zentralen religiösen Raum ein. Er treibt die Tiere hinaus, stößt die Tische der Geldwechsler um und benennt laut, was aus dem Tempel geworden ist: kein Ort des Gebets mehr, sondern eine Räuberhöhle.
Dieses Handeln wird gelegentlich als Gewaltausbruch gedeutet, nicht zuletzt mit Verweis auf die „Geißel aus Stricken“. Doch nirgends ist davon die Rede, dass Jesus Menschen verletzt. Die Szene beschreibt keine körperliche Gewalt gegen Personen, sondern eine symbolisch zugespitzte Handlung. Lärm, Bewegung und Unordnung dienen hier dazu, Aufmerksamkeit zu erzwingen und ein Unrecht offenzulegen, das sich im religiösen Alltag eingerichtet hat.
Gerade darin zeigt sich erneut die Logik der Gewaltfreiheit Jesu. Er greift nicht an, um zu zerstören, sondern um sichtbar zu machen. Seine Handlung ist konfrontativ, aber nicht verletzend; störend, aber nicht vernichtend. Sie zielt auf Unterbrechung und Klärung, nicht auf Eskalation.
Im Zusammenhang von Jesu öffentlichem Wirken wird deutlich, dass dieses Ereignis kein isolierter Vorfall ist. Es steht in einer Linie mit Sabbatheilungen, mit der Vergebung von Schuld außerhalb des Tempelkults, mit der Aufwertung von Menschen am Rand der Gesellschaft. Immer wieder wird sichtbar, dass dort, wo das Reich Gottes Raum gewinnt, bestehende religiöse und soziale Ordnungen ins Wanken geraten. Nicht, weil Ordnung an sich abgelehnt würde, sondern weil sie sich vom Leben entfernt hat.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die Spannung, die viele Friedenskirchen bis heute im Blick auf öffentliche Konfrontation empfinden. In der Geschichte der Mennonit:innen spielte Zurückhaltung eine große (negative) Rolle. Sie ist nicht zuletzt geprägt durch frühe Verfolgungserfahrungen, durch Gewalt, Ausgrenzung und den Versuch, durch Rückzug das eigene Überleben zu sichern. Gewaltfreiheit wurde dabei oft mit Stille und Unsichtbarkeit verbunden.
Zunehmend wächst jedoch die Einsicht, dass Schweigen nicht neutral ist. Inzwischen dürften auch die Letzten dies verstanden haben. Wo Unrecht bestehen bleibt, stabilisiert Zurückhaltung den Status quo. Das gilt in besonderer Weise für strukturelle Formen von Ungerechtigkeit, etwa für den Rassismus, der unsere Gesellschaft bis heute durchzieht. Gewaltfreiheit darf hier nicht mit Passivität verwechselt werden. Sie fordert vielmehr ein Handeln, das sichtbar wird, das irritiert und das bestehende Ordnungen infrage stellt – ohne selbst zerstörerisch zu werden.
Als Friedenskirche sind wir deshalb gerufen, diesen Formen von Unrecht entgegenzutreten, und zwar mit gewaltfreien Mitteln in ihrer ganzen Vielfalt: durch Gehen und Bleiben, durch Schreiben und Sprechen, durch Aufklärung und praktische Hilfe, durch Fürsprache, Organisation und politischen Einsatz. In all dem setzen wir die Bewegung fort, die mit Jesu öffentlichem Wirken begonnen hat, und bezeugen das anbrechende Reich Gottes mitten in einer widersprüchlichen Welt.
In diesem Zusammenhang lohnt es sich, an die Worte von Martin Luther King Jr. zu erinnern: „Ein Aufruhr ist die Sprache der Ungehörten.“ Gewaltsame Ausbrüche verweisen auf lange überhörte Erfahrungen von Ausgrenzung und Entrechtung. Sie machen sichtbar, wie hartnäckig sich gesellschaftliche Verhältnisse gegen Veränderung sperren. Unsere Antwort darauf kann nicht die Rechtfertigung von Gewalt sein, wohl aber die Bereitschaft, genauer hinzusehen und klarer zu benennen, wie ein friedliches, gerechtes und allen Menschen zugewandtes Zusammenleben aussehen kann.
Die Beteiligung an Protesten und öffentlichen Auseinandersetzungen fordert uns dabei zugleich zur Selbstprüfung heraus. Sie verlangt, eigene Annahmen, kirchliche Traditionen und eingeübte Praktiken kritisch zu hinterfragen. Insbesondere wir weißen Mennonit:innen sind aufgerufen, den Erfahrungen von Geschwistern aus anderen kulturellen und ethnischen Kontexten aufmerksam zuzuhören und uns von ihnen korrigieren zu lassen, wenn wir gemeinsam nach Wegen suchen, Jesu Auftrag heute glaubwürdig zu leben.
Vor diesem Hintergrund erhält auch die Aufforderung Jesu, Barmherzigkeit gegenüber Feinde zu leben, ihr konkretes Gewicht. Sie meint keine sentimentale Haltung und keine innere Distanzierung von realem Unrecht. Gemeint ist vielmehr ein barmherziges Handeln, das Situationen entschärft, Gewaltspiralen unterbricht und Ungerechtigkeit sichtbar macht. Feindesliebe zielt nicht auf Harmonie um jeden Preis, sondern auf Klärung – auf eine Wahrheit, die ausgesprochen wird, ohne den anderen zu vernichten.
So verstanden erweist sich Gewaltfreiheit nicht als weltfremdes Ideal, sondern als eine nüchterne und zugleich anspruchsvolle Praxis. Sie verlangt Mut zur Konfrontation ebenso wie die Bereitschaft zur Selbstbegrenzung. Sie hält Spannung aus, ohne sie zu eskalieren, und widerspricht dort, wo Schweigen das Unrecht schützt. In einer komplexen Welt ist sie kein einfacher Weg, aber ein realistischer.
Wer diesen Weg geht, setzt die Bewegung fort, die mit Jesu Leben begonnen hat: eine Bewegung, die das Reich Gottes nicht durch Macht oder Zwang herbeiführt, sondern durch barmherziges, widerständiges und verantwortliches Handeln – mitten in den Widersprüchen dieser Welt.
Friedenskirche, Täufwerbewegung, Mennoniten

